



Alte Farben in neuen Bindern
Im Rahmen eines Projektes an der Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein sollte eine Maltechnik gefunden werden, die den Dialog von Vergangenheit und Gegenwart sinnfällig zum Ausdruck bringen sollte. Die Wahl fiel auf eine Maltechnik, bei der historische Pigmente, vorwiegend mineralische und natürliche, mit einem modernen, alterungsstabilen Bindemittel kombiniert werden sollte. Die Pigmente sollten größtenteils selbst hergestelllt oder in der Natur selbst gesammelt werden. Als Ergebnis war eine Maltechnik entstanden, die sich durch große Vielseitigkeit und Ausdrucksstärke auszeichnete:
Die Pigmente
Es wurden ausschließlich Pigmente verwendet, wie sie einem römischen Maler etwa in der Zeit vom 1. Jhdt. v. Chr. bis 4. Jhdt n.Chr. zur Verfügung gestanden haben könnte. Aus diesem Spektrum wurden nur anorganische, "mineralische" Pigmente ausgewählt, wegen deren außerordentlich hohen Lichtechtheit und Alterungsbeständigkeit (im Gegensatz zu Pflanzenfarben wie etwa Farblacken). Die Pigmente wurden aus den Rohmaterialien durch Stampfen und Reiben im Mörser gemahlen, wobei unterschiedliche Feinheiten, von sandig - grob bis mittelfein, mehlartig, erzeugt wurden. Die Feinheit moderner industrieller Pigmente wurde nicht angestrebt und auch bei weitem nicht erreicht. Durch das teils mit dem bloßen Auge erkennbare Korn sollte ein urstofflicher, archaischer Materialeindruck entstehen.
Die verwendeten Pigmente:
 |
Calcitmehl, Rügener
Kreide und Marmorstaub (Calciumcarbonat) Kalk dient in seiner natürlichen Form als Kreide, Marmor oder Calcit seit alters her als weißes Pigment. Rügener Kreide und Calcitmehl kann man vom Farbhandel beziehen (oder in Rügen sammeln). Marmorstaub kannman auch als Abfallprodukt von Marmorsägereien, die vorzugsweise weißen Marmor verarbeitet, beziehen. Kalkpigmente dürfen nicht mit zuviel Bindemittel versehen werden, da sie sonst nicht mehr richtig decken. |
 |
Gelber Ocker Den gelben Ocker kann man bequem selber sammeln, dazu braucht man nicht einmal nach Frankreich zu fahren. Man muß lediglich die Augen in der Natur offenhalten für schön gelbe Verfärbungen im Erdreich. Oft findet man schöne Gelbocker in Zusammenhang mit Tonerdelagerstätten.
|
 |
Roter Ocker hier handelt es sich wohl um das älteste Rotpigment überhaupt, es wurde schon in der Altsteinzeit verwendet. Rotocker ist der Sammelbegriff für weit verbreitete, tonige Erden, die einem Gehalt von ca. 5-20% an rotem Eisen(III)-oxid (Hämatit) ihre lebhaft braunrote Farbe verdanken. In der Antike war die "Sinopische Erde" aus Kleinasien besonders berühmt und begehrt. Deutsche Vorkommen liegen vor allem im Lahngebiet, im Westerwald und in Bayern. Brauchbare dunkle Rotocker finden sich auch im Mansfelder Land. Eine Art Rotocker erhält man auch, wenn man gelben Ocker brennt, was schon bei Temperaturen ab 500 Grad aufwärts gelingt. Rotocker kann man sich ähnlich einfach selber sammeln wie den gelben Ocker. Sachsen-Anhalts ältester Farbtopf, ein Keramikgefäß der späten Bronzezeit, hat Rotocker enthalten, und es ist nachgewiesen, daß die Wände bronzezeitliche Häuser mit einem Streifendekor aus Rotocker auf weißem Grund dekoriert waren. |
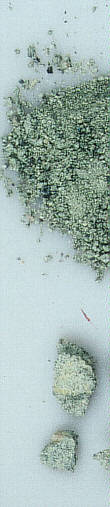
|
"Grüne Erde"
|
 |
Malachit Malachit ist ein natürliches Material, und zwar ein Kupfererz. Chemisch gesehen ist es ein basisches Kupfercarbonat. Malachit wurde in der Vorgeschichte nicht nur zur Metallgewinnung abgebaut. Besonders reine Sorten von Malachit fanden als Pigment in der Malerei Verwendung. In großen Stücken ist Malachit dunkel-smaragdgrün, in pulverisiertem Zustand von hellgrüner, leicht türkisstichiger Farbe. Man kann heute natürliches Malachit (z.B. aus dem Mineralienhandel) pulverisieren und als Pigment verwenden. Ein einfacherer, billigerer Weg ist jedoch, den käuflichen, synthetischen Malachit zu verwenden. Bei der Verarbeitung achte man darauf, daß keine Pigmentstäube eingeatmet werden, denn Malachit ist auf Grund seines Kupfergehaltes gesundheitsschädlich.
|
 |
Caeruleum,
"Ägyptischblau"
(Kupfer-Calcium-Silikat) Der früheste Befund für diese Farbe stammt aus Ägypten der 4. Dynastie (2700-2500 v-. Chr.). Das Pigment wurde im römischen Reich in großem Umfange "industriell" hergestellt. Im römischen Architekturlehrbuch "Vitruvii De Architectura Libri Decem" (1. Jahrhundert n. Chr.) ist der Herstellungsprozeß beschrieben. Um die begehrte blaue Farbe zu erhalten, mischte man eine mehlfeine Masse aus reinem Quarzsand, Kalk und Soda mit groben Kupferspänen, befeuchtete die Mischung mit wenig Wasser, formte aus der Masse mit der Hand kleine Klöße, die nach dem Trocknen im Glühofen bei bei ca. 850 Grad C gebrannt wurden. Dabei erhielt man harte blaue Kugeln. Um das Pigment daraus zu erhalten, wurden die Kugeln anschließend zermahlen und ausgewaschen. Wer einen Brennofen hat, kann sich dieses Blau selber herstellen., man kann es edoch auch fertig "beim Kremer" kaufen. Ägyptischblau wurde im römischen Reich häufig verwendet. Bei aller "Schönheit" der Farbe sollten auch die Nachteile nicht unerwähnt bleiben: Das Material ist glasartig hart und folglich sehr schwer zu zerkleinern und zu reiben. Und zu fein darf es auch nicht gemahlen werden, weil sonst die Farbe stark zurückgeht.
|
 |
Cassler
Braun
|
 |
Rebschwarz
|
Stoffliche Wirkung
Auch wenn man nur oder vorwiegend Erdfarben verwendet, d.H. kaum brillante, "bunte" Farben nimmt, kann damit Bilder von einer tiefen Leuchtkraft und kräftigen Farbigkeit entstehen. Das ist besonders dann der Fall, wenn man auf hellen Untergründen arbeitet. Erdfarben, insbesondere gelbe Ocker, entfalten in lasierenden Farbauftrag auf hellen Gründen eine größere Leuchtkraft, als wenn sie dickschichtig deckend aufgetragen werden. Wenn man dann noch komplementäre Farben geschickt gegeneinandergesetzt, beispielsweise Malachit gegen den roten Ocker, wird die Farbwirkung erheblich gesteigert. Und als besondere Akzente kann man wenige ehemals "teure" reinfarbigere Pigmente verwenden, aber nur sparsam, ähnlich wie ein Gewürz. Die historischen Pigmente erzeugen einen harmonische Farbklang. Das kann daran liegen, daß diese Farbstimmungen von frühen Kulturen an bis zu Beginn des Industriezeitalter die menschliche Ästhetik geprägt haben. Oder daran, daß wir der beliebig bunten Alltagswelt mit ihrem inflationären Gebrauch von brillanten Farben überdrüssig sind.
Der erdig-mineralische Charakter der Malschichten mit den mal glatten, mal rauen, strukturierten Oberflächen läßt Assoziationen wie "erdig", "archaisch" oder "Vergänglichkeit" und "Ewigkeit" aufkommen, und spricht damit vielleicht die Sehnsucht des modernen Menschen nach Ursprünglichkeit an.
![]()